Transidentität: Dem Gefühl für das Kind trauen und ihm folgen
Transidente Kinder und Jugendliche stärken!
Immer öfter ist zu lesen, wie aus Ingo Inga oder aus Lea Leo geworden ist. In Schulen ist Transidentität nach Ansicht von Expert*innen aber nach wie vor nicht ausreichend Thema. Privatdozentin Dr. Birgit Möller leitet am Universitätsklinikum Münster eine Spezialsprechstunde für Kinder und Jugendliche mit Geschlechtsdysphorie. Im Interview mit der nds erklärt die Psychologin, wie Betroffene mit dieser Diagnose umgehen können.

nds: Was bedeutet es für junge Menschen, wenn sie glauben, im falschen Körper zu stecken?
Dr. Birgit Möller: Erstmal häufig ein Gefühl von Irritation. Viele haben Angst, nicht normal zu sein. Sie wissen nicht, dass es natürlich ist, sich in einem Körper und zugewiesenen Geschlecht nicht beheimatet zu fühlen. Ist jemand bereits im Jugendalter, beginnt meist eine intensive Suche nach Antworten – häufig über das Internet und LSBTI*-Seiten, weil auch die sexuelle Orientierung dann eine immer größere Rolle spielt. Oder man sieht eine Fernsehdokumentation oder Sportler*innen, die sich als transident outen. Auf einmal gibt es einen Namen dafür, was meist mit großer Erleichterung verbunden ist: Das ist es, und so bin ich auch.
Was läuft nach so einer Erkenntnis in den Familien ab, können Sie einen Beispielfall schildern?
Das ist sehr unterschiedlich, ich kann mehrere Beispiele nennen. Sie sehen ein biologisches Mädchen, das sich schon immer burschikos gab, kurze Haare trug, Fußball spielte. Die Eltern meinten, „Das ist halt so“. Wenn mit elf oder zwölf Jahren die Brüste wachsen und die Regelblutung einsetzt, erhöht sich für das Kind der Leidensdruck; es setzt ein Erkenntnis- und Bewusstseinsprozess ein, und der Trans*junge offenbart seinen Eltern: „Ich bin ein Junge, ich spüre das deutlich.“ Manche Eltern sind nicht überrascht und reagieren verständnisvoll, weil sie schon lange entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Sie sagen: „Jetzt verstehen wir endlich – auch warum es dir so schlecht geht, seit du in der Pubertät bist. Nun gucken wir, was wir tun können, wie wir dich unterstützen, und wo wir Hilfe bekommen können.“
Und ein Fall, in dem es nicht so ideal läuft?
Manche Eltern fallen aus allen Wolken, wenn ihr Kind ihnen in der Pubertät so etwas mitteilt. Sie sind völlig überrascht von dieser Situation, die sie nicht wahrgenommen haben und die sie irritiert und beunruhigt. Sie müssen das erst verarbeiten und einen Umgang damit finden. Den meisten Kindern wurde nicht von heute auf morgen deutlich, dass sie an ihrem zugewiesenen Geschlecht zweifeln. In der Regel gibt es einen längeren Vorlauf der intensiven Auseinandersetzung damit – häufig allein oder im Austausch mit engen Freund*innen, nicht mit den Eltern. So kommt es, dass diese sich überrumpelt fühlen. Bestenfalls entsteht dann ein Austausch, wie es nun weitergehen kann. Manchmal reagieren Eltern infolge eigener Ängste sehr ablehnend und setzen ihr Kind unter Druck, sich nicht weiter in diese Richtung zu entwickeln, die gefühlte Geschlechtsidentität nicht nach außen zu tragen oder sich entsprechend zu zeigen. Oder sie bestrafen ihr Kind und drohen mit dem Ausschluss aus der Familie – also genau mit dem, wovor sich Kinder und Jugendliche fürchten, wenn sie sich outen. In seltenen Fällen kommt es dazu, dass Kinder in eine Jugendwohngruppe ziehen müssen.
Welche Ratschläge geben Sie Eltern?
Das Wichtigste ist, genau hinzugucken, was das Kind braucht, damit es sich weiter gut entwickeln kann. Wenn Eltern verunsichert sind, können sie auch zu uns kommen oder sich an Beratungsstellen und Vereine wie Trakine wenden. Dort können sich Eltern oder Betroffene Hilfe holen oder erst einmal Fragen stellen. Die Eltern müssen dem Gefühl für ihr Kind trauen und ihm folgen. Mit dem Kind in Kontakt sein und seine Äußerungen und Wünsche ernstnehmen. Dazu gehört zum Beispiel, dafür zu sorgen, dass sich das Kind im Kindergarten zeigen und ausleben kann und mit dem Wunschnamen angesprochen wird.

Beobachten Sie bei Eltern je nach Bildungsniveau einen unterschiedlichen Umgang damit?
Ich habe diese Frage noch nie wissenschaftlich untersucht. Ad hoc würde ich sagen: nein. In allen Gesellschaftsschichten gibt es Eltern, die sich schwerer damit tun und welche, die das annehmen und ihrem Kind das Gefühl vermitteln können, dass es so geliebt wird, wie es ist. Manchmal spielen die Religion oder ein kultureller Hintergrund eine tragende Rolle. Aber auch da gibt es erstaunliche Entwicklungen in Familien, die zum Beispiel dem muslimischen Glauben angehören – in dem Transidentität eher stigmatisiert wird oder negativ besetzt ist. Doch es gibt Eltern, die tolle Wege beschreiten, damit ihr Kind sich entfalten kann.
Wie viele Kinder und Jugendliche in NRW sind Ihrer Einschätzung nach transident?
Eine repräsentative Studie für NRW existiert nicht. Wir können auf Zahlen der Inanspruchnahme unserer Sprechstunde zurückgreifen, die es seit 2014 gibt. Aktuell zählen wir mehr als 500 Kinder und Jugendliche. Im Mittel sind diese 14 Jahre alt – die Kleinsten 4, die Ältesten 20. Bis zu diesem Alter behandeln und begleiten wir die Therapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Trans*mädchen sind im Schnitt 13,5 und die Trans*jungen 14,5 Jahre alt, wenn sie zu uns in die Ambulanz kommen. Das hängt mit der pubertären Entwicklung und dem steigenden Leidensdruck zusammen. Bislang betrug der Anteil etwa 31 Prozent Trans*mädchen. Es gibt aktuell eine Entwicklung, auch in der internationalen Literatur, dass es mehr Trans*jungen als Trans*mädchen gibt.
Stichwort Behandlung: Was empfehlen Sie Betroffenen?
Wir warten immer erst den Beginn der Pubertät ab; internationale Studien und Langzeitverläufe haben gezeigt, dass das eine wichtige Phase ist. Es gibt deutliche Hinweise auf ein Fortschreiten der bisherigen Entwicklung und einen steigenden Leidensdruck, der körpermedizinische Maßnahmen notwendig macht. Im Hinblick auf Langzeitverläufe wissen wir, dass es bei Jugendlichen, die schon als Kind Hinweise auf eine transidente Entwicklung gezeigt und im gefühlten Geschlecht gelebt haben, eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das so bleibt. Bei anderen Kindern und Jugendlichen galt die Prognose, dass sie sich in der Pubertät mit dem Körpergeschlecht versöhnen, in jüngsten Studien zu 50 Prozent. Es ist niemals mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, in welche Richtung es geht. Wir beobachten den Prozess, begleiten ihn und besprechen Empfehlungen mit der Familie als Grundlage von Entscheidungen.
Im Fall einer körpermedizinischen Behandlung ist der erste Schritt die Pubertätsblockade. Das ist eine reversive Behandlung, das heißt die Hormone können wieder abgesetzt werden und die Entwicklung nimmt ihren normalen Lauf. In der Zeit, in der sie blockiert wird, kann man schauen, ob sich die Geschlechtsidentitätszugehörigkeit des Kindes weiter verfestigt. Spätestens zwei Jahre nach Erstgabe der pubertätsblockierenden Hormone sollte die gegengeschlechtliche Hormontherapie beginnen.
Und was gilt für jüngere Kinder?
Da muss man erst einmal gar nichts machen. Bei kleineren Kindern beraten wir die Eltern, damit diese ihr Kind auf dem Weg zu einer guten Entwicklung begleiten können. Typische Fragen sind etwa: Soll ich dem Kind erlauben, mit Mädchenkleidung, langen Haaren und Mädchennamen herumzulaufen? Oder machen wir einen Fehler und drängen es damit in eine bestimmte Richtung? Wie können wir die Wünsche des Kindes in sein Umfeld integrieren und wie mit den Erzieher*innen sprechen? Manchmal wünschen sich auch Erzieher*innen mehr Informationen und wir telefonieren mit ihnen.
Wie können Pädagog*innen erkennen, dass ein Kind transident ist?
Indem sie aufmerksame Beobachter*innen sind: hinschauen und hinhören, was das Kind auf verbaler Ebene und auf Verhaltensebene oder im Spiel symbolisch mitteilt. Und wenn es Hinweise gibt, mit den Eltern darüber sprechen. Es braucht nicht viel, sondern nur das, was ohnehin Aufgabe von Erzieher*innen ist: wahrnehmen, was das Kind benötigt, um sich gut entwickeln zu können. Da ist die Geschlechtsidentität nur ein Aspekt – ein bedeutsamer, aber nur einer. Erzieher*innen brauchen trotzdem eine entsprechende Weiterbildung. Die geschlechtliche Vielfalt und der professionelle Umgang damit sind aus meiner Sicht bislang viel zu wenig in den Curricula verankert.
Wie können Fachkräfte darüber hinaus ihre Kitagruppe oder Schulklasse vorbereiten?
Die Vorbereitung in der Kita hatte ich persönlich bisher noch nicht. Grundsätzlich ist es aber so, dass es eine andere Natürlichkeit hat. Da kann es reichen, im Stuhlkreis in kindlicher Sprache und Form zu erklären, dass Transidentität normal und in Ordnung ist. Mit Schulen habe ich dagegen viel Erfahrung. Dort gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, das hängt von den Jugendlichen, der Klasse und den Lehrkräften ab. Manche Jugendliche sind unglaublich mutig, stellen sich vor die Klasse und erzählen ihre Geschichte. Häufig stoßen sie auf positive Resonanz, Respekt und Achtung. Manche trauen sich das nicht so direkt und gestalten mit Lehrkräften gemeinsam eine Unterrichtsstunde zu diesem Thema. Es gibt mittlerweile auch tolles Bildmaterial – Videos und Dokumentationen, in denen transidente Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Geschlechts porträtiert werden. Lehrkräfte können dieses Material in einer Unterrichtseinheit zeigen, darüber sprechen und am Ende sagen: Übrigens, Tom oder Nina sind in einer ähnlichen Situation wie die Menschen aus dem Film.
Das klingt optimal. Aber ist Transidentität tatsächlich ausreichend Thema in Schulen, haben Lehrkräfte genug Hintergrundwissen?
Beides nein. Darum telefonieren wir viel mit Lehrkräften und Schulleitungen. Transidentität sollte Teil der Curricula und als Unterrichtseinheit fest etabliert werden. Schulen müssen Bedingungen schaffen, damit geschlechtliche Vielfalt gelebt werden kann. Viele Lehrer*innen sind mutig, arbeiten sich in die Thematik ein und finden gute Wege, mit Schüler*innen und Eltern zusammen ein solches Umfeld zu bieten. Es gibt aber auch Lehrer*innen, die sich weigern, den Jugendlichen beim gewählten Namen und mit dem entsprechenden Personalpronomen anzusprechen. Das führt dazu, dass Jugendliche täglich die diskriminierende Erfahrung machen, nicht anerkannt zu werden. Daher braucht es Fortbildungen und Konzepte sowie eine Art Leitfaden zur Orientierung.
Haben Sie auch Forderungen an die Gesundheitspolitik?
Auch in den ärztlichen und therapeutischen Curricula muss das Thema fest verortet werden – sowohl in der medizinischen Ausbildung von Studierenden als auch in den Fortbildungsakademien der Ärztekammern. Wir haben bei uns viele Anfragen von niedergelassenen Kolleg*innen oder anderen Institutionen, die Supervisions- und Fortbildungsbedarf haben. Das muss man strukturell anders abdecken.
Wenn Sie sich etwas für die Familien wünschen könnten, was wäre das?
Mehr niedrigschwellige Angebote, von Peer-group-Beratungen bis zu psychotherapeutischen Maßnahmen. Es gibt nach wie vor eine massive Unterversorgung. Wir haben Wartezeiten von mehreren Monaten, bis Patient*innen einen Erstvorstellungstermin bekommen. Das ist natürlich unerträglich – gerade, wenn Jugendliche in die Pubertät kommen und man schnell eingreifen sollte. Wer zu uns kommt, reist zudem häufig von weither an. Da wünsche ich mir eine flächendeckendere Versorgung. Und eine engere Zusammenarbeit von Schulen, Kitas und dem Gesundheitswesen. Steigt in der Pubertät der Leidensdruck stark an, weil die Jugendlichen ihre Bedürfnisse verleugnen und sich verzweifelt anpassen müssen oder die Reaktionen des Umfelds sehr negativ sind, kann dies dramatische Folgen haben, zum Beispiel Depressionen und Suizidalität.
Die Fragen stellte Nadine Emmerich.
Fotos: .marqs, Miss X, Mar Castellanos, skabarcat, greenpapillon / photocase.de; UKM Pressestelle

Auf Stimmenfang
Auf Stimmenfang mit Fragen der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung zu gehen, gehört bei der AfD zum Standardrepertoire. Hauptsache dem Stammtisch gefällt‘s.
Provozieren, Themen setzen. Offenbar kein Problem, auch wenn es auf Kosten von Minderheiten geht. Da will die AfD in NRW nicht abseits stehen. Im Landtag thematisiert sie das „dritte Geschlecht“ im schulischen Leben beziehungsweise im Unterricht. Sie gibt vor, Sachfragen zu stellen – und zeigt dennoch, wie sehr ihr daran gelegen ist, die Thematik ins Lächerliche zu ziehen und fürsorgende Politik zu diskreditieren. Sie sollte sich schämen.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Dimension des Problems für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen beschrieben: „Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt auch die geschlechtliche Identität, die regelmäßig ein konstituierender Aspekt der eigenen Persönlichkeit ist. Der Zuordnung zu einem Geschlecht kommt für die individuelle Identität herausragende Bedeutung zu; sie nimmt typischerweise eine Schlüsselposition sowohl im Selbstverständnis einer Person als auch dabei ein, wie die betroffene Person von anderen wahrgenommen wird. Dabei ist auch die geschlechtliche Identität jener Personen geschützt, die weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen sind.“
Gut, dass die Landesregierung kompetent antwortet und der AfD den Wind aus den Segeln nimmt. Einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung aller Schüler*innen zu leisten, ist zentrale Aufgabe von Schulen. Dazu gehört auch Transidentität.
Sebastian Krebs

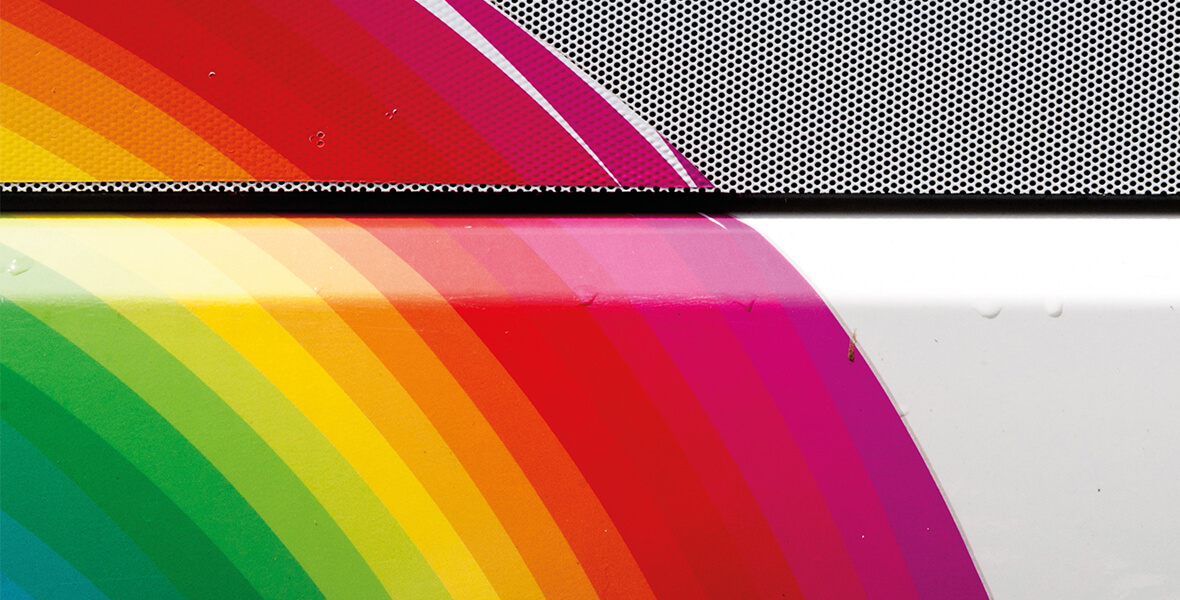
 Demokratie: Schule legt den Grundstein!
Demokratie: Schule legt den Grundstein!  Judenfeindlichkeit oder legitime Kritik an israelischer Regierungspolitik
Judenfeindlichkeit oder legitime Kritik an israelischer Regierungspolitik  Mitbestimmung für Schüler*innen: Demokratie an Schule leben
Mitbestimmung für Schüler*innen: Demokratie an Schule leben 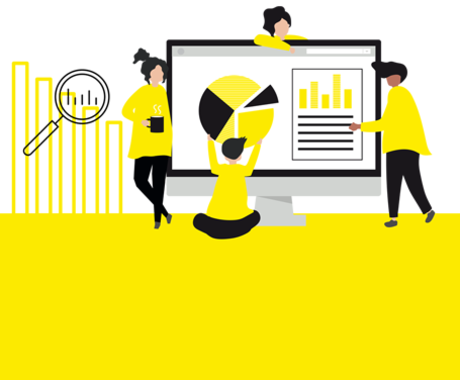 Kommentar: Schwarz-gelber (Unterrichts-)Ausfall
Kommentar: Schwarz-gelber (Unterrichts-)Ausfall
Kommentare (0)
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Lassen Sie es uns wissen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!