Rechtschreibung will gelernt sein
Schulische Inklusion
Wer nicht richtig schreiben kann, hat in der gesamten Bildungsbiografie mit Vorurteilen zu kämpfen. Doch nur selten steckt hinter den Fehlern eine echte Lese-Rechtschreib-Störung. In vielen Fällen kommt es vielmehr auf gezielte Förderung und ein gutes Zusammenspiel von Familie und Lehrkräften an, damit Inklusion beim Schriftsprach- erwerb gelingen kann.

Lehrkräfte unterliegen Differenzierungs- und Selektionswidersprüchen: Sie sollen die Kinder und Heranwachsenden einerseits in ihrer Individualität wahrnehmen und fördern; andererseits gilt es, ihre Leistung zu bewerten und damit die Allokationsfunktion von Schule wahrzunehmen, das heißt den Schulabgänger*innen je nach Leistung Anwartschaften auf soziale Positionen zu eröffnen. Die Leistungsgerechtigkeit – so könnte man vermuten – entspricht der Verteilungsgerechtigkeit.
Wie ist das aber, wenn Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen die Schule betreten? Wenn diese unterschiedlichen Voraussetzungen durch Schule nicht kompensiert, sondern noch vertieft werden? Wie steht es dann mit der Bildungsgerechtigkeit, wie mit der Inklusion?
Unterschiedliche Startbedingungen
Der Schriftspracherwerb ist eines der fundamentalen Vorhaben gleich zu Beginn der Schulzeit. Er hat wesentlichen Anteil an allen bildenden Prozessen. Den meisten gelingt dieses Vorhaben im Laufe ihrer Schulzeit, aber zunehmend mehr Kinder entwickeln Probleme mit den Kulturtechniken Rechtschreiben und Lesen. Auch hier spiegeln sich die ungleichen Eingangsvoraussetzungen wider. So sind zum Beispiel je nach Verfügbarkeit kulturellen Kapitals in den Familien, also der lese- und schreibfreudigen Umgebung, die Kinder vor der Schule bereits unterschiedlich mit Sprache und Schrift in Berührung gekommen. Einem geringen Prozentsatz der Kinder – man spricht von fünf bis acht Prozent – gelingt aufgrund noch nicht gänzlich geklärter neurologischer Störungen das einwandfreie Schreiben- und Lesen-Lernen nicht. Gleichzeitig wird der Rechtschreibung in Deutschland nach wie vor hohe Bedeutung beigemessen.
Rechtschreibung als Selektionsinstrument
Anstelle einer sorgfältigen Analyse der Bedingungen, die zu den Fehlleistungen führen, sehen sich Lehrkräfte in der (vermeintlichen) Pflicht, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Rechtschreibleistung zu benoten. Damit wird Rechtschreibung vorrangig als Selektionsinstrument genutzt. Es fehlen Zeit und Strukturen für eine diagnosebasierte Förderung. Rechtschreiblernende erhalten gerade in den weiterführenden Schulen selten bis nie individuelle professionelle Hilfestellung bei ihren Problemen. Gleichzeitig werden ihre Leistungen wegen fehlerhafter Rechtschreibung abgewertet. Wenn Rechtschreibförderung stattfindet, wird sie leider zu oft nach dem Gießkannenprinzip verteilt, entsprechende Effekte bleiben so natürlich aus. Dabei geben die Erkenntnisse der modernen Graphematik, die die Forscher Hartmut Günther, Utz Maas und Peter Eisenberg untersucht haben, Anhaltspunkte für eine sinnvolle Intervention.
Darüber hinaus problematisch: Die Lesekompetenz in deutschen Schulen steht längst nicht so im Fokus wie die Rechtschreibung – anders in den angelsächsischen Ländern. Dabei bezieht die Rechtschreibung ihre Daseinsberechtigung aus der Lesenützlichkeit; Lesen ist die Schlüsselkompetenz für Schul- und Bildungserfolg. Mangelnde sprachdidaktische Expertise sowie fehlendes Wissen um die Ursachen für Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten und -Störungen führen dazu, dass Lehrende sich hilflos, nicht selten allein gelassen fühlen und die Rechtschreibprobleme ihrer Schüler*innen fehldeuten.
Rechtschreibung als Barriere
In dieser Situation kommt es immer häufiger zu einer Pathologisierung von Schüler*innen mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit (LRS): Sie haben also LRS, wie man eine Krankheit hat; Rechtschreibung wird zur Barriere. In einigen Fällen wird ein Verfahren entsprechend der Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung eingeleitet, um institutionelle Ressourcen lockerzumachen, was Stigmatisierungsprozesse für die betroffenen Kinder zur Folge hat. Nicht selten sind es die Familien selbst, die an dieser Entwicklung beteiligt sind – sie erhoffen sich Entlastung von zeitlichem und von Notendruck und in der Folge eine leistungslogisch unbeschadete Schulkarriere für ihr Kind. Anstelle von Arbeitsbündnissen zwischen Schule und Elternhaus werden also inflationär klinische Diagnosen eingefordert, die das Kind hinsichtlich der Kulturtechniken als zukunftsuntauglich deklarieren, und damit innerhalb schulischer Strukturen Nachteilsausgleiche eingeklagt. So erzeugt das derzeitige Konzept von Inklusion seine eigenen Klient*innen. Bildungsgerechtigkeit im Sinne von Leistungsgerechtigkeit gleich Verteilungsgerechtigkeit funktioniert nur, wenn Minderleister*innen als solche markiert und damit stigmatisiert werden, wie hier durch klinische Gutachten. Das gängige Konzept von Schule widerspricht also in seinen inneren Strukturen bereits dem Konzept von Inklusion.
Legasthenie oder erworbene LRS?
Nur bei sehr wenigen in Schule auffälligen Rechtschreiber*innen kann von einer Lese-Rechtschreib-Störung (früher: Legasthenie) im Sinne der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der Weltgesundheitsorganisation (ICD-10) gesprochen werden. In den weitaus meisten Fällen handelt es sich um erworbene LRS – durch bildungsferne Elternhäuser, didaktogene Fehler im Schriftsprachunterricht sowie als Folgeerscheinungen anderer Störungen oder Krankheiten. Sie sind als Entwicklungsverzögerung zu betrachten und könnten durch entsprechende Förderung oder Behandlung der Ursachen kompensiert werden. Zuallererst müsste der diagnostische Blick der Lehrkräfte, vor allem der Deutschlehrkräfte, geschärft werden.
Was macht der Umgang mit LRS mit den betroffenen Kindern und Heranwachsenden? Untersuchungen zeigen, dass diese Entwicklung nachhaltige Folgen für sie nach sich ziehen: Es gelingt ihnen auch als Erwachsene nicht, sich als ernstzunehmende Teilnehmer*innen einer kulturellen Gemeinschaft (cultural peers) zu fühlen, ihr Selbstkonzept ist beschädigt und es kommt zum Gefühl mangelnder Autonomie und fehlender Selbstwirksamkeit. In der Tat fühlen sie sich ihr Leben lang als behindert im Sinne einer „Minus-Variante menschlicher Existenzformen“, wie es Erziehungswissenschaftler Dieter Katzenbach in seiner Veröffentlichung „Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik“ beschreibt.
Drei strukturelle Ebenen der Rechtschreibförderung
Um dieser Stigmatisierung vorzubeugen, ist eine eindimensionale Perspektive auf das Geschehen nicht ausreichend. Vielmehr müssen drei strukturelle Ebenen in den Blick genommen werden. Auf einer makrostrukturellen Ebene ist eine geänderte Sicht auf die Rechtschreibung angezeigt: Ihre Regularitäten dienen der Leseerleichterung. Gegenüber dem vielfach behaupteten Chaos deutscher Rechtschreibung weist sie eine hoch regelhafte Struktur auf – diese Normierung dient dem schnellen Lesen und sollte nicht zu Selektionszwecken missbraucht werden. Die sprachdidaktische Expertise gewährt Lehrkräften Einsicht in die Schriftarchitektur des Deutschen und befähigt sie, diagnosebasiert zu fördern. Zum anderen hilft sie, solche Kinder zu erkennen, die in der Tat massive, womöglich neurologisch fundierte Störungen im Schriftspracherwerb haben.
Damit ist die mesostrukturelle Ebene tangiert: „Die Vorstellung von Bildung als knappem Gut“ – ein Begriff, den der Wissenschaftliche Leiter des Oberstufen-Kollegs Martin Heinrich 2015 in einer kritischen Auseinandersetzung mit der schulischen Inklusion verwendet – verfehlt eine Bildungsbegegnung, die die Lehrkraft das Kind beziehungsweise den Heranwachsenden als Einzelfall in den Blick nehmen lässt. Sie führt zu selektiven Prozessen, als deren Instrument Rechtschreibung parasitär genutzt wird – anstatt ihre hochgradige Strukturiertheit aufzusuchen und sie – ermutigend – in ihrer Regularität lehr- und lernbar zu machen. Lehrkräfte sollten in den Schulen Strukturen vorfinden, die dem Lehren und nicht dem Benoten der Kulturtechniken Priorität einräumen. Dazu gehören neben der angesprochenen sprachdidaktischen, von den Lehrkräften einzubringenden linguistischen Expertise Möglichkeiten des Teamteachings, finanzielle Ressourcen für die Anschaffung entsprechenden Materials und Organisation eines Schulalltags, in dem eine Begegnung von Lehrenden und Lernenden so ermöglicht wird, dass Arbeitsbündnisse entstehen.
Erst dann gelingt es auf der Mikroebene schließlich, dass auch Kinder mit LRS als entwicklungsfähig und zukunftsoffen und nicht in der „Sonderrolle der Invalidität“ wahrgenommen werden, wie es der Soziologe Ulrich Oevermann zum Integrationsverlust des Individuums erklärt. Dann hätten wir Inklusion in den Schulen.
Dr. Susanne Wilckens
Einzelfall-Fachberaterin für LRS in der Bezirksregierung Düsseldorf, Deutsch- und Philosophielehrerin am Amplonius-Gymnasium in Rheinberg
Fotos: iStock.com / BrianAJackson, BraunS


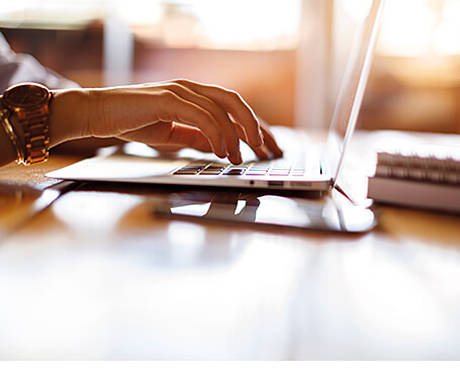 Lehrkräfte jetzt für Digitalisierung ausstatten!
Lehrkräfte jetzt für Digitalisierung ausstatten!  Schule ohne Rassimus: „Vielfalt macht uns stark!“
Schule ohne Rassimus: „Vielfalt macht uns stark!“  So geht Europa in Schule und Hochschule
So geht Europa in Schule und Hochschule  Politische Bildung: Globale Konflikte zivilgesellschaftlich lösen
Politische Bildung: Globale Konflikte zivilgesellschaftlich lösen
Kommentare (0)
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Lassen Sie es uns wissen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!