Zwei-Säulen-Modell: Eine gute Alternative für NRW?
Gymnasium und Gemeinschaftsschule
Der Schulkonsens läuft demnächst aus. Für die Zeit danach diskutiert die SPD darüber, die zersplitterte Schullandschaft in NRW zu einem Zwei-Säulen-Modell nach Hamburger oder Bremer Vorbild weiterzuentwickeln: Gymnasium und Gemeinschaftsschule.
Die Zwei-Säulen-Modelle aus Hamburg und Bremen existieren schon seit 2009 beziehungsweise 2010, sodass viel Erfahrung vorliegt: Das erste Konzept eines zweigliedrigen Schulsystems, das in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgte, stammt von dem Bielefelder Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Klaus Hurrelmann. Er veröffentlichte es 1991 als Zwei-Wege-Modell in der Wochenzeitung „Die Zeit“ unter dem Titel „Zwei Schulen für das eine Deutschland. Offener Brief an die Konferenz der Kultusminister“ anlässlich der deutschen Wiedervereinigung.
Gymnasium und Oberschule im Zwei-Wege-Modell
Klaus Hurrelmann plädierte für ein einheitliches Schulsystem in ganz Deutschland, um einheitliche Lebensverhältnisse zu sichern. Die erste Säule sollte das Gymnasium bilden, unverändert, als theoretisch-wissenschaftlich ausgerichtete Schule. Daneben sollte gleichberechtigt eine berufs- und praxisorientierte neue Oberschule als zweite Säule entstehen, „für alle, die sich vom Gymnasium nicht angezogen fühlen“. Alle anderen Schulformen, auch die Gesamtschule, sollten in dieser neuen Säule aufgehen. Die pädagogischen Erfahrungen der Gesamtschule sollten dazu dienen, schwierige Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf dort aufzunehmen. Dafür sollte die neue Oberschule Sozialpädagog*innen bekommen und als Ganztagsschule geführt werden. Reformpädagogische Vorstellungen, ein „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ könnten hier zum Programm werden, schwärmte Klaus Hurrelmann.
Selbstverständlich war die Oberschule auch als Schule gedacht, in die das Gymnasium „nicht geeignete“ Schüler*innen abgeben konnte. Sie war gedacht als Schule für alle Kinder mit Problemen, während das Gymnasium Kinder unterrichten sollte, die keine Lernprobleme hatten. Allerdings sollte auch diese zweite Säule eine Oberstufe bekommen, die ähnlich der Kollegschule berufsorientiert wäre. Kinder und Eltern sollten die freie Wahl zwischen den beiden Schulformen haben.
Das Zwei-Säulen-Modell kommt im Praxistest an seine Grenzen
Im Jahr 2010 wurde in Hamburg ab Klasse 5 ein Zwei-Säulen-Modell eingerichtet, das dem Hurrelmannschen Modell weitgehend entspricht. Das Gymnasium blieb in alter Form bestehen; alle anderen Schulen, auch die Gesamtschulen, wurden zu Stadtteilschulen mit gymnasialen Oberstufen. 2016, nach sechs Jahren Erfahrung, wandten sich die Schulleiter*innen der Stadtteilschulen jedoch mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit. In einem Artikel in „Die Zeit“ vom 7. Juli 2016 stellten sie fest: „Das Zwei-Säulen-Modell mit Gymnasium und Stadtteilschule funktioniert nicht.“ Was war geschehen? „Die Stadtteilschulen können sich anstrengen wie sie wollen. Solange die Eltern die Wahl haben zwischen einer Schulform, die den Aufstieg in die Welt der Erfolgreichen verspricht, und einer Schulform, auf der die vermeintlichen Problemkinder und sozial Schwachen lernen, werden sie sich mehrheitlich für das Gymnasium entscheiden“, warnte die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule Hamburg schon im April 2016 in einer Presseerklärung. Auch die Entwicklung der Schüler*innenzahlen zeigt deutlich, dass immer mehr Kinder am Gymnasium angemeldet werden und immer weniger leistungsstarke Schüler*innen zur Stadtteilschule gehen. 20 Prozent der Gymnasiast*innen werden nach der sechsten Klasse wieder abgeschult und müssen von den Stadtteilschulen aufgenommen werden. Die Stadtteilschulen übernehmen 60 Prozent der Kinder mit besonderem Förderbedarf und die meisten Klassen mit Geflüchteten.
Hamburgs Schulsenator Ties Rabe hält dagegen, die Stadtteilschulen seien erfolgreich. Sie hätten die Zahl der Schulabbrecher*innen um ein Viertel gesenkt, die Zahl der Abiturient*innen verdoppelt und 50 Prozent mehr Schüler*innen in Ausbildungsstellen vermittelt. Das spricht für die gute und erfolgreiche Arbeit der Stadtteilschulen. Doch die Schulleiter*innen fordern eine Schule für alle. Nur so könne die soziale Spaltung der Schulen überwunden werden, äußerten sie sich in der Zeitung „Die Welt“ im Juni 2016.
Bis heute, zwei Jahre später, hat sich trotz guter Ausstattung und vieler Anstrengungen der Stadtteilschulen, die Eltern von den Vorteilen inklusiver Bildung zu überzeugen, an den Problemen wenig geändert. Die Parteien scheuen jede Veränderung, die in Richtung einer gemeinsamen Schule gehen würde.

Zweigliedrigkeit – eine Lösung für die zersplitterte Schullandschaft in NRW?
Die Schullandschaft in NRW ist zersplittert: Gymnasium, Gesamtschule, Realschule, Hauptschule, Gemeinschaftsschule, Sekundarschule, Primusschule, daneben alle Förderschultypen. Es wäre zweifellos eine Vereinfachung für Kommunen und Eltern, gäbe es nur noch zwei Schulformen – und Förderschulen.
Allerdings hat Hamburg gezeigt, dass ein Zwei-Säulen-Modell der sozialen Ungleichheit im Bildungswesen nur bedingt entgegenwirken kann. Zwar machen mehr Schüler*innen Abitur und weniger verlassen die Schule ohne Abschluss, dank der individuellen Förderung an der Stadtteilschule. Solange jedoch das Gymnasium von der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung für langsam Lernende, Behinderte und Geflüchtete befreit ist und die ganze Verantwortung allein bei der zweiten Säule liegt, trägt diese Aufteilung erheblich zur sozialen Spaltung der Schullandschaft bei. Eltern bevorzugen Schulen ohne Probleme. Die Möglichkeit, „nicht geeignete“ Schüler*innen nach Klasse 6 an die zweite Säule abzugeben, bereinigt das Milieu der Mittel- und Oberschicht von unpassenden Elementen.
Ein Zwei-Säulen-Modell kann die soziale Spaltung der Gesellschaft verfestigen. Es könnte aber auch ein Weg zu einer Schule für alle sein, wenn der politische Wille dafür vorhanden wäre und entsprechende Entwicklungsschritte eingeleitet würden. Als 2008 die Einführung des Zwei-Säulen-Modells in Bremen diskutiert wurde, stellte Bremens Bildungs- und Wissenschaftssenatorin Renate Jürgens-Pieper das Bildungskonzept als Zwischenschritt dar: Nur 25 Prozent der Schüler*innen sollten zum Gymnasium gehen, 75 Prozent zur Oberschule. Allerdings geht auch in Bremen die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung: Der gymnasiale Anteil wird ausgeweitet und die Trennung in zwei unterschiedliche Säulen verfestigt.
Von zwei Säulen zu einer gemeinsamen Schule für alle
Damit das Modell gelingt, müssten die beiden Schulformen auf Augenhöhe kooperieren. Die Gymnasien wären in der Pflicht, selektive Elemente wie Sitzenbleiben und Abschulen abzubauen. Alle Kinder, die in die fünfte Klasse aufgenommen werden, würden demnach zu einem passenden Abschluss geführt werden. Dafür müsste das Gymnasium alle Abschlüsse vergeben können oder ein einheitlicher Abschluss der Sekundarstufe I eingeführt werden. Beide Säulen wären anteilig an den aktuellen pädagogischen und bildungspolitischen Herausforderungen Inklusion und Integration beteiligt. Für Gymnasien würde das den Abschied von der Fiktion bedeuten, homogene Klassen zu unterrichten und störende Schüler*innen abgeben zu können. Die Fiktion der Homogenität müsste durch einen bewussten Umgang mit Heterogenität ersetzt werden.
Dazu sind praktische Hilfen nötig: Die Lehrer*innenausbildung und -fortbildungen sollten den Umgang mit Heterogenität in den Mittelpunkt stellen und auch gymnasiale Lehrkräfte in Methoden des individuellen und kooperativen Lernens und in Förderkonzepten schulen. Die Schulorganisation müsste auf multiprofessionelle Teams ausgerichtet werden, die wichtigste Ressource für einen erfolgreichen Umgang mit Inklusion und Integration.
Wenn die beiden Säulen mit unterschiedlichem historischen Ansatz in der Lage wären, mit der pädagogischen auch die soziale Selektion in der Bildung zu überwinden, wäre der Schritt zu einer gemeinsamen Schule vorstellbar. Die unschöne Alternative ist ein ständiges Wachstum der gymnasialen Säule bei gleichzeitigem Schrumpfen der zweiten Säule bis zur Bedeutungslosigkeit und schließlich ihre Integration in die erste Säule. In NRW stehen die Chancen zurzeit schlecht, dass die SPD Mut zu einem Vorstoß hat, über eine Zweigliedrigkeit die
gemeinsame Schule zu entwickeln.
Prof. Dr. Anne Ratzki
Institut zur Förderung der Teamarbeit und Schulentwicklung
Foto: BeneA / photocase.de; iStock.com / shironosov

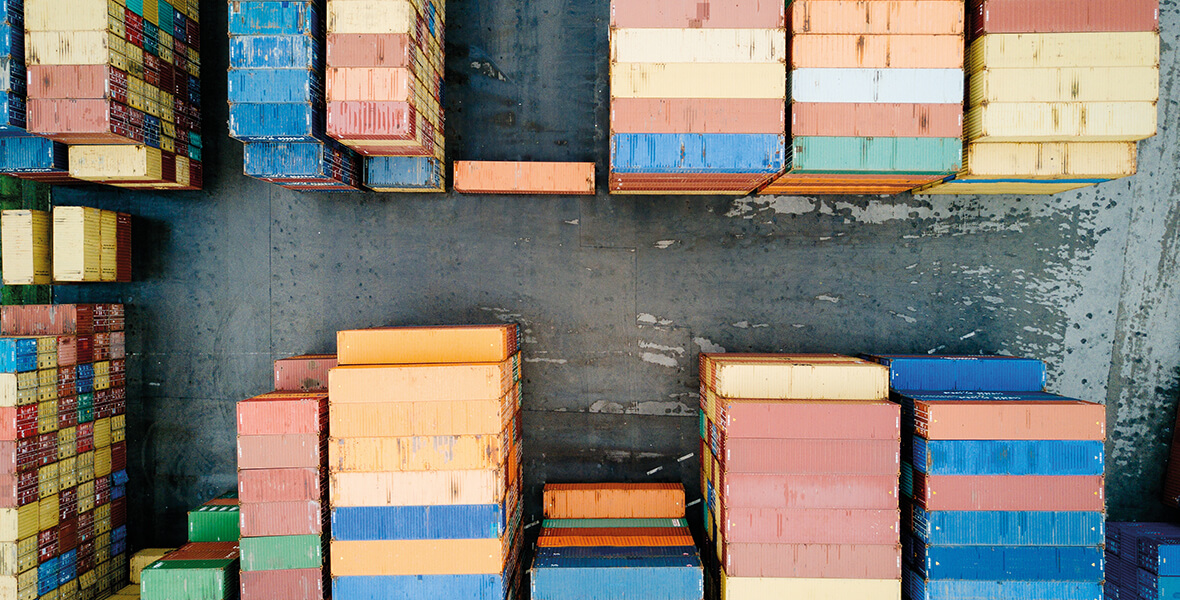
Kommentare (0)
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Lassen Sie es uns wissen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!