Aufstieg durch Bildung ermöglichen
Im Gespräch mit Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani
Wie stark der schulische Erfolg von der sozialen Herkunft abhängt, belegen PISA-Studien immer wieder. „Bildung gegen Spaltung“ lautete deshalb das Motto des Gewerkschaftstags der GEW NRW am 25. November 2017 in Duisburg. Zu Gast: Bildungsforscher Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani. Die nds sprach mit ihm über dauerhafte Herausforderungen, emotionale Krisen und die Vision einer Schule, die Armut ausgleichen kann.
nds: Im Ruhrgebiet wird die Kluft zwischen Arm und Reich geografisch sehr anschaulich – durch die A 40. Südlich der Autobahn wohnen meist gebildete, gut situierte Familien. Nördlich wohnen jene, die schlechter ausgebildet sind und weniger Geld zur Verfügung haben. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani: Dass es sich um ein ziemlich symmetrisches soziales Süd-Nord-Gefälle handelt, hat mit der spezifischen Geschichte des Ruhrgebiets zu tun. Aber die Konzentration von Armut sowie die Konzentration von Reichtum können wir in allen Städten erkennen. Dieses Phänomen wird soziale Segregation genannt und ist das Ergebnis von sehr vielen einzelnen Entscheidungen, häufig auch von historisch gewachsenen Strukturen. Armutssegregation wird dabei immer sehr intensiv diskutiert und als Problem erkannt.
Reichtumssegregation wird bestenfalls zur Kenntnis genommen. Dabei sind die Entscheidungen von einkommensstarken Personen entscheidend für Segregationsprozesse. Je wohlhabender eine Person oder ein Haushalt ist, desto freier ist die Wohnortwahl. Und interessanterweise führt diese Freiheit dazu, dass die Wohlhabendsten sich sehr einheitlich verhalten: Sie suchen ihresgleichen. Den ärmsten Menschen bleibt in der Regel nichts anderes übrig, als dort zu wohnen, wo es die günstigsten Mietpreise gibt – und die sind dort günstig, wo die meisten nicht wohnen wollen. Sie finden notgedrungen ihresgleichen, es handelt sich nicht um eine wirkliche Wahlfreiheit. So entsteht eine räumliche Konzentration von Ober- und Unterschicht, wobei die Oberschicht deutlich konzentrierter unter sich bleibt. Am wenigsten voraussehbar sind Entscheidungen der sozialstrukturellen Mitte.
Es geht im Übrigen nicht um Schuldzuweisungen. Diese Prozesse verlaufen zum Teil ohne böse Absicht. Aber mir ist schon wichtig hervorzuheben, dass nicht die ärmeren Menschen Segregation erzeugen, sondern eher die Wohlhabenden.
Was macht es denn so schwierig aufzusteigen? Wie schafft ein armes Kind aus einem Problemviertel den Aufstieg?
Das ist eine dauerhafte Herausforderung voller emotionaler Krisen und Konflikte. Der Aufstieg durch Bildung hat in einer Langzeitperspektive zur Folge, dass sich der Mensch grundlegend verändert, was auf der einen Seite Identitätsprobleme, Unsicherheitsgefühle und Verlusterlebnisse mit sich bringt. Zudem kommt es im Verhältnis zur Herkunftsfamilie und dem Milieu zu einem Distanzierungsprozess, der bis zur Entfremdung führen kann. Aufstieg wird allgemein als mühevoll und durchweg positiv begriffen. Mühevoll ist er, aber aus der Erlebensperspektive von Aufsteiger*innen ist er auch ambivalent, nicht nur positiv, zeitweise sogar eher negativ. Vieles von dem, was in der Kindheit und Jugend wertvoll war, wird im Aufstiegsprozess entwertet. Viele soziale Beziehungen können nicht gehalten werden. Während des Aufstiegs fühlt man, dass man etwas verliert, ohne sich sicher sein zu können, ob man etwas gewinnt, ob man den Aufstieg wirklich schafft und sich „oben“ etabliert.
Auch unabhängig von Migration lässt sich der Aufstieg aus benachteiligten Milieus auf diese Weise beschreiben. Heranwachsende aus Migrant*innenfamilien haben lediglich andere Voraussetzungen: Einerseits sind sie aufstiegsorientierter, was förderlich ist. Andererseits sind sie mit besonders ausgeprägten Loyalitätserwartungen aus ihrem Herkunftsmilieu konfrontiert, die – wie gesagt – zumindest zum Teil enttäuscht werden. Familien ohne Migrationshintergrund sind hingegen weniger erfolgsorientiert und haben auch weniger Loyalitätserwartungen. Das sind sehr unterschiedliche Voraussetzungen, die zu sehr unterschiedlichen, aber ähnlich komplexen Herausforderungen führen.

Welche Rolle spielt die Schulform in diesem Zusammenhang?
Neben der sozialen Segregation innerhalb von Städten trägt die Selektion im Schulsystem zusätzlich dazu bei, dass sich Armut und Wohlstand konzentrieren. Das würde selbst dann passieren, wenn die Selektion fair wäre, was sie aus verschiedenen Gründen nicht ist. Das ist für die Kinder verheerend und kann sich auf die gesamte Biografie auswirken. Soziale Durchmischung in der Schule wäre natürlich besser als Segregation – übrigens auch für die Lehrkräfte.
Lassen Sie mich einen paradoxen und bisher nicht reflektierten Zusammenhang schemenhaft erläutern, der für Schulen und Lehrkräfte zentral ist. Punkt 1: Ganz unterschiedliche Studien zeigen, dass von Schüler*innengeneration zu Schüler*innengeneration die Leistungsfähigkeit der Heranwachsenden besser wird. Egal ob es um den IQ oder um Kompetenzen geht: Es wird tendenziell besser! Punkt 2: Lehrkräfte erleben das anders. Ziemlich einstimmig singen sie das Lied von den immer schwieriger werdenden Arbeitsbedingungen. Die Schüler*innen brächten immer weniger mit, die Leistungsfähigkeit gehe zurück.
Punkt 3: Beides stimmt! Denn die Bildungsexpansion schreitet schneller voran als die Steigerung der Kompetenzen und des IQ. Während sich der Anteil der Schüler*innen auf dem Gymnasium verdoppelt hat, haben sich IQ und Kompetenzen zwar verbessert, aber bei Weitem nicht verdoppelt. Dadurch entsteht der Effekt, dass sich der Durchschnitt in jeder Schulform verschlechtern kann, obwohl sich der Durchschnitt des schulformübergreifenden Geburtsjahrgangs verbessert hat. Die ehemals leistungsstärksten Realschüler*innen sind heute auf dem Gymnasium, die ehemals besten Hauptschüler*innen besuchen heute die Realschule und so weiter. Lehrkräfte haben einen selektiven Blick innerhalb des selektiven Schulsystems. Und Wissenschaftler*innen haben einen repräsentativen Blick aus dem Elfenbeinturm heraus.
Nimmt man beide Perspektiven ernst und führt sie zusammen, kommt man zu Punkt 4: Hätten Lehrkräfte einen repräsentativen Ausschnitt des gesamten Geburtsjahrgangs vor sich sitzen, würden auch sie die Verbesserungen bemerken. Dafür müsste man zum einen regionale und innerstädtische Unterschiede ausgleichen – das ist unrealistisch. Zum anderen müsste die Selektion einige Jahre später einsetzen – das ist nicht nur realistisch, sondern international gesehen die Regel.
Was müsste Schule denn leisten, um die Ausgangsbedingungen auszugleichen und möglichst vielen Kindern den Aufstieg durch Bildung zu ermöglichen?
Wenn ich jetzt sage, dass individuelle Förderung und ein Ganztagsschulprogramm dafür die beiden zentralen Aspekte sind, könnte man meinen: „Das machen wir schon.“ Ich meine aber, dass das fast keine Schule in einer Form macht, die das Thema Armut wirklich in den Mittelpunkt rückt. Ich rede nicht von verschiedenen Lerntypen, von diversifizierten Arbeitsblättern oder Hausaufgabenbetreuung – all das ist sinnvoll, hat aber mit dem Ausgleich von Armut noch nichts zu tun.
Nehmen wir die individuelle Förderung: Wer Kinder in prekären Lebensverhältnissen individuell fördern will, muss Armut verstehen. Sie erzeugt eine soziale Mentalität, ein Denk- und Handlungsmuster, einen Habitus. Kluge Kinder, die arm sind, denken und handeln kurzfristig, praktisch und unsicherheitsvermeidend. Das ist der Zwang der strukturellen Knappheit, ähnlich wie bei einem Insolvenzverwalter: Auch er muss kurzfristig eine praktische Lösung finden, die sicher sein muss, weil die Situation der Insolvenz dieses und kein anderes Verhalten erzwingt. Wenn Kinder dauerhaft unter struktureller oder extremer Knappheit aufwachsen, dann etabliert sich dieses Muster und lässt sich nur noch mit viel Mühe aufbrechen. Diese Kinder müssten deshalb systematisch dort abgeholt werden, mit dem Ziel, auch andere Denkmuster zu erlernen: Langzeitorientierung, die Fähigkeit der Abstraktion und das Denken in Alternativen. All das sind übrigens Denkmuster, die wohlhabend aufwachsende Kinder aufgrund ihrer Sozialisationsbedingungen mitbringen. Es geht also um grundlegende Ziele, um Bildung im engeren Sinne und nicht lediglich darum, das Lernen zu optimieren.
Und wie müsste ein Ganztagsschulprogramm aussehen, das Armut entgegenwirkt?
Schön wäre es, wenn Kinder ihre Lehrkräfte als Menschen besser kennenlernten, wenn sie Kunst und Kultur permanent erlebten und selbst machten, wenn sie Musikinstrumente spielen lernten und Sport in der Schule stattfände – genauso wie ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen. Natürlich auch handwerkliches Arbeiten, anregende naturwissenschaftliche Angebote, debattieren, tanzen ... Gut, ich will mal die Aufzählung der Maximalforderungen abbrechen, aber verstehen Sie sie als Kompass! Es geht darum, dass Kinder alles erleben, was unsere Welt zu bieten hat. Besonders arme Kinder erleben nur einen sehr kleinen Ausschnitt des Möglichen. Davon würden alle profitieren, nicht nur die Kinder: Wenn wir uns fragen, wie diese Gesellschaft überhaupt noch zusammengehalten werden kann, dann wären das Möglichkeiten, um eine gemeinsame Erfahrungsgrundlage zu schaffen.
Aber natürlich braucht das alles mehr zeitliche und ökonomische Ressourcen. Es ist erschütternd, wie fantasielos in Zeiten von Haushaltsüberschüssen über mögliche Zukunftsinvestitionen diskutiert wird. Das Problem liegt aber nicht nur in der Politik. Auch die Bildungsforschung ist mäßig anregend und trägt zur Problemlösung bisher kaum bei. Es gibt tatsächlich keine armuts- oder ungleichheitssensible Didaktik und auch Kulturvermittlung und -angebote erreichen bisher selten die Zielgruppe, die es am nötigsten hätte. Für arme Menschen, selbst für arme Kinder interessieren sich noch immer viel zu wenige.
Die Fragen für die nds stellte Jessica Küppers
Fotos: time. / photocase.de, Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani


 A 13 Z: Den Worten müssen Taten folgen
A 13 Z: Den Worten müssen Taten folgen  Hochschule: Die GEW NRW bietet volle Unterstützung
Hochschule: Die GEW NRW bietet volle Unterstützung 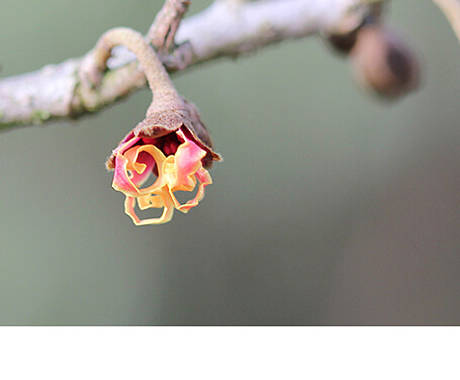 Fachhochschulen: Personalentwicklung weiterdenken
Fachhochschulen: Personalentwicklung weiterdenken  Fachhochschulen sind Motor für Innovation
Fachhochschulen sind Motor für Innovation  Fachhochschulen: Professor*innen dringend gesucht
Fachhochschulen: Professor*innen dringend gesucht 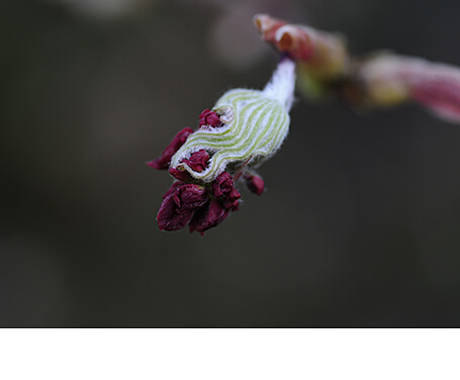 Fachhochschulen: Weiterentwicklung zum Nulltarif?
Fachhochschulen: Weiterentwicklung zum Nulltarif?
Kommentare (0)
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Lassen Sie es uns wissen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!